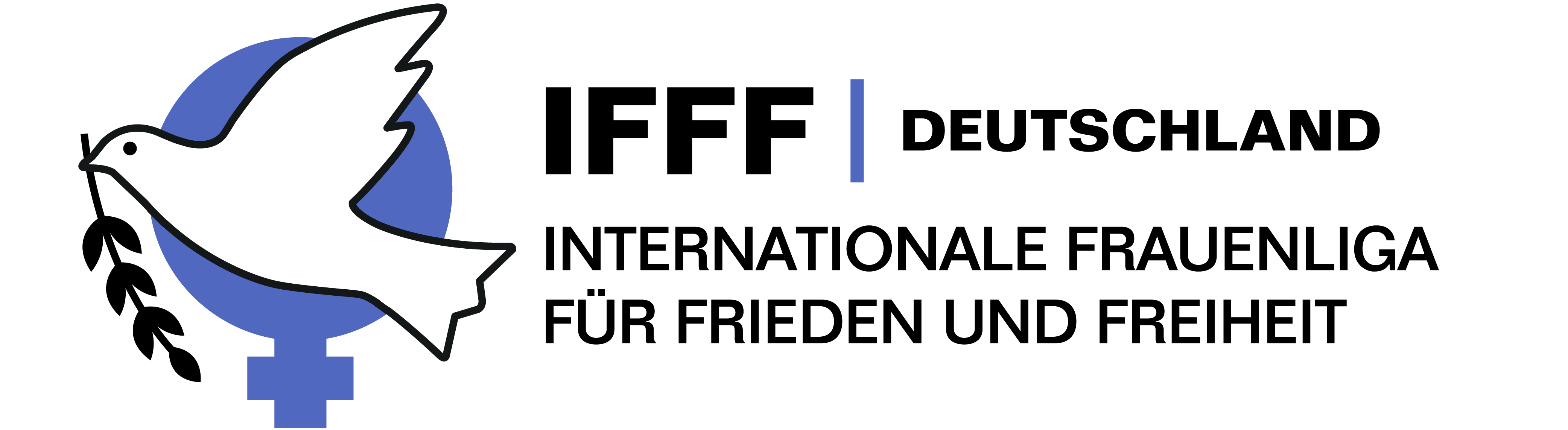Geschichte

„Wir Frauen so vieler verschiedener Nationalitäten, die wir uns, um unsere Gefühle auszudrücken, verschiedener Sprachen bedienen müssen, von denen eine jede ihre eigenen nationalen Charakterzüge trägt, sind hierher gekommen, in dem gleichen Bewußtsein, mit den gleichen Hoffnungen, dem einen Wunsch, daß unsere Stimme bis ans Ende der Erde dringe im Protest gegen diesen fürchterlichen Massenmord und gegen die Annahme, Krieg sei der einzige Weg, internationale Konflikte auszutragen.“
Mit diesen Worten eröffnet Dr. Aletta Jacobs, erste praktizierende Ärztin in den Niederlanden und Vorsitzende des niederländischen Zweiges der Internationalen Frauenstimmrechtsbewegung, den 1. Internationalen Kongress europäischer und amerikanischer Frauen vom 28. April bis zum 1. Mai 1915 in Den Haag.
Der 28. April ist der Gründungstag der Women's International League for Peace and Freedom (WILPF).
Rund 1200 delegierte Frauen sind zum Teil unter größten Schwierigkeiten aus 12 kriegsführenden und neutralen Ländern angereist, weitere 300 Besucherinnen und Beobachterinnen nehmen teil.
Welche Brisanz dieses internationalen Treffen besitzt, läßt sich deutlich an den Reaktionen der kriegsführenden Länder verfolgen: Sondererlasse sollen die Einreise in die Niederlande verhindern – deutsche Frauen werden in der Mehrzahl an der Grenze abgewiesen, nur 28 von ihnen erreichen Den Haag. Von den 180 britischen Delegierten erhalten nur 25 Frauen ein Visum – und selbst diese können die Reise nicht antreten, da der Ärmelkanal für die zivile Schifffahrt gesperrt ist.
Die wichtigsten Ergebnisse des Frauenfriedenkongresses nach intensiver Diskussionen:
- Delegationen werden zu den einzelnen europäischen Regierungen entsandt, um die in Den Haag gefaßten Beschlüsse zu überreichen und Friedensverhandlungen zu forcieren.
Zur Weiterführung der internationalen Arbeit gründen die teilnehmenden Frauen das Internationale Komitee für dauernden Frieden, mit Sitz in Den Haag. - Einzelne Länder sollen veranlaßt werden, Nationale Frauenausschüsse für dauernden Frieden zu gründen.
Die Resolutionen können hier nachgelesen werden.
In Deutschland sind es Frauen der radikal-bürgerlichen Frauenbewegung, hauptsächlich vertreten durch den Frauenstimmrechtsbund, die von deutscher Seite aus den Friedenskongress unterstützen, ihn mit vorbereiten und durchführen.
Unter den 28 Frauen, die nach Den Haag gelangen, sind Anita Augspurg, Constanze Hallgarten, Lida Gustava Heymann, Auguste Kirchhoff, Elisabeth Rotten, Emmy von Schlumberger und Margarethe Selenka. Damit werden sie erheblichen Schwierigkeiten seitens der Militärbehörden ausgesetzt und von nationalistischer Seite heftig angegriffen. Immer mehr stehen ihre Arbeit und ihre Forderungen im Gegensatz zu der gemäßigten Mehrheit der bürgerlichen Frauenbewegung.
Im gemeinsamen Dachverband, dem Bund Deutscher Frauen (BDF), werden die Differenzen deutlicher, als dieser ungeachtet seines Grundsatzes politischer Neutralität zunehmend die nationalistische Politik des Wilhelminischen Reiches unterstützt.

Nach Kriegsende ist es schließlich 1919 möglich, den in 1915 Den Haag gefassten Beschluss zu realisieren und einen internationalen Kongress nach Zürich einzuberufen. Um dem Status einer ständigen Institution zu entsprechen, beschließen die Frauen auf Antrag von Anita Augspurg, das Internationale Komitee für dauernden Frieden umzubenennen in Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF/WILPF).
Der Sitz der Organisation ist fortan in Genf, dort, wo auch der eben gegründete Völkerbund tagt.
Ein Auszug des Konferenzberichts ist hier zu finden.

Trotz der Anfeindungen in Deutschland von nationalistischer Seite setzt sich der Gedanke friedlicher Lösungen von internationalen Konflikten, die Forderung nach voller politischer Gleichberechtigung von Frauen und der Schaffung einer neuen sozialen und wirtschaftlichen Ordnung durch: In den Städten Deutschlands entstehen bald überall regionale Arbeitsgruppen. Bereits 1919 gibt es 42 Gruppen, 1928 sind es 80 Gruppen mit mehr als 2000 Mitgliedern.
Verbindendes Organ unter den Gruppen ist die von Lida Gustava Heymann und Anita Augspurg herausgegebene Monatsschrift Die Frau im Staat; das erste Heft erscheint im Januar 1919, das letzte im März 1933.
Vom 4. bis 6. Januar 1929 findet der Internationale Kongress der IFFF in Frankfurt am Main zum Thema „Die modernen Kriegsmethoden und der Schutz der Zivilbevölkerung“ statt. Zum Ehrenkomitee gehören Albert Einstein, Romain Rolland, Bertrand Russel, Käthe Kolliwtz und Selma Lagerlöff. Als Referent*innen sind zahlreiche Wissenschaftler*innen geladen, unter ihnen auch die Berner Chemie-Professorin Gertrud Woker, Mitglied der Schweizer IFFF. Ihre Forderungen gehen ein in die Planung einer internationalen Abrüstungskonferenz, die 1932 in Genf einberufen wird. Der Einsatz für soziale und politische Gleichberechtigung bestimmt – immer neben der Verfolgung friedenspolitischer Ziele und Abbau des Militarismus – das Wirken der IFFF seit ihrer Gründung.
Doch bald nach Ende des Ersten Weltkrieges sind in Deutschland die Zeichen erneut auf Militarisierung und steigende Kriegsproduktion gesetzt. Das Wettrüsten geht weiter. Die IFFF versucht mit Flugblättern und öffentlichen Kundgebungen und Seminaren die Bevölkerung aufzuklären, sie wachzurütteln. Doch die Frauen der IFFF selbst geraten zunehmend unter Druck. Von wachsendem Faschismus bedroht, entschließen sich einige aktive Mitstreiterinnen 1933 zur Emigration (wie auch Lida Gustava Heymann, Anita Augspurg, Frida Perlen, Constanze Hallgarten). Andere bleiben in Deutschland (u.a. Auguste Kirchhoff), gehen in den Untergrund, werden verfolgt, verhaftet (u.a. Magda Hoppstock-Huth). Ihre Wohnungen werden durchsucht, Büros geschlossen, Unterlagen vernichtet, der Besitz konfisziert.
Die deutsche WILPF-Sektion zählt zu den ersten Organisationen, die ‚aufgelöst‘ werden. Das Kapitel der Frauenfriedensbewegung soll ausgemerzt werden. Doch noch kurz zuvor, im Januar 1933 fand im Münchner Hofbräukeller die letzte Friedenskundgebung der IFFF statt. Bis auf den letzten Platz war der Saal gefüllt. 800 bis 1 000 Zuhörer*innen lassen sich von dem Versuch der SA, die Versammlung mit Stinkbomben zu sprengen, nicht beirren und hörten zum letzten Mal die Warnung:
„Hitler bedeutet Krieg, schützt Eure Kinder, laßt Euch nicht von diesen Phrasen bluffen; hinter diesen Phrasen steht die brutalste Gewaltpolitik, die ihr alle am Leib zu spüren bekommt. Gebt keine Stimme für Hitler, der der Handlanger Eurer Ausbeuter, Euer Feind ist! Schließt Euch zusammen, organisiert Euch für Frieden und Freiheit!“
- Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit
Wenige Tage später ist die Mahnung Wirklichkeit geworden.
Im ersten Aufruf der IFFF-Frauen, die den Faschismus überlebt haben, heißt es:
„… den Einfluß des noch bestehenden Faschismus auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens auszumerzen und das Denken zu befreien von dem Ungeist völkischer Überheblichkeit und des Rassenhasses … Wir wollen beitragen zu der Erkenntnis, daß nur gegenseitige Achtung und gegenseitiges Vertrauen die Kräfte sind, auf deren Grundlage das Zusammenleben der Menschen und Völker neu gestaltet werden kann …“.
Wesentlichen Anteil an der Reorganisation der deutschen Sektion hat Magda Hoppstock-Huth, Mitglied der IFFF seit 1916. Sie wirkt von Hamburg aus, wo sie 1946 in das Hamburger Parlament berufen wurde. Unter größten Mühen reiste sie, die die KZ-Haft überlebt hat, ihrem Todesurteil entgehen konnte, durch das Land und innerhalb kurzer Zeit nach Zulassung der IFFF in den westlichen Sektoren entstanden Gruppen in vielen Städten.
Trotz des Schwurs “Nie wieder Krieg!” sind es bald wieder alte Strukturen, gegen die sich die Arbeit der Frauen- und Friedensorganisationen richten: Remilitarisierung und Aufstellung einer Bundesarmee. Die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland erscheint allen als ein Hohn.
Im sowjetisch verwalteten Sektor und in der späteren Deutschen Demokratischen Republik (DDR) kommt es zu keinen Neugründungen der IFFF. Ihre Aufgaben – so wird argumentiert – werden vom jüngst gegründeten Dachverband der Demokratischen Frauenföderation wahrgenommen. Wenn möglich, arbeiten beide Organisationen in der Verfolgung ihrer Ziele zusammen.
Auf internationaler Ebene nahm die WILPF 1945 an der Gründungskonferenz der Vereinten Nationen in San Francisco teil. Auf der Konferenz warb die WILPF für das Konzept der Weltsicherheit (world security) auf der Grundlage von Freiheit und Gerechtigkeit und nicht von militärischer Macht und Prestige. Zwei Jahre später erhielt die WILPF den beratenden Status einer Nichtregierungsorganisation beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) und setzt sich seitdem für eine Weiterentwicklung bzw. Reformierung der Vereinten Nationen ein.
Die antikommunistischen Strömungen in Deutschland der fünfziger Jahre wendet sich in erster Linie gegen die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), deren Jugendverband FDJ und den Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD). Die Organisationen werden verboten, die führenden Frauen und Männer werden verfolgt und strafrechtlich belangt.
Doch der Antikommunismus richtet sich gegen die gesamte Friedensbewegung. 1959, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, wird ein Komitee Rettet die Freiheit unter der Leitung des Christdemokraten Rainer Barzel gegründet. Im Jahr 1960 erscheint das sogenannte Rotbuch mit einer langen Liste von Hunderten von Namen und Organisationen, die als ‚kommunistisch gesteuert‘ erklärt werden – es wird der Presse und allen Parteien zugeschickt. Aufgelistet findet sich auch die IFFF, eine kommunistische Tarnorganisation!
Dagegen reicht die deutsche Sektion Klage ein – und sie gewinnt den Prozess. Doch der Schaden in der deutschen Sektion ist groß: Viele der engagierten Frauen springen ab und finden keinen Mut, weiter für die IFFF zu arbeiten. Es bleiben die Gruppen in West-Berlin, Hamburg, Bremen, München und Duisburg bestehen.
Inmitten des Kalten Krieges appellierten die Ligafrauen gemeinsam mit Friedensaktivist*innen an die westdeutsche Bevölkerung, wachsam zu bleiben, sich faschistischen und antisemitischen Tendenzen zu widersetzen, entschlossen gegen eine Remilitarisierung Westdeutschlands vorzugehen und sich für einen Ost-Westdialog einzusetzen. Dafür standen ihre Veranstaltungen zumindest in Bayern bis 1967 unter polizeilicher Beobachtung.
Ligafrauen waren bei den Protesten gegen die Lagerung von Atomwaffen auf deutschem Boden und im Kampf für einen Atomwaffenteststopp in der ersten Reihe zu finden. In der Ostermarschbewegung spielte Christl Küpper als Mitorganisatorin eine große Rolle. Die Liga erstellte die erschütternde Broschüre „Kindheitserinnerungen aus Hiroshima“ für die Robert Jungk das Vorwort schrieb und engagierte sich im Rahmen einer internationalen Bewegung gegen den Vietnamkrieg.
Ligafrauen beteiligten sich in Deutschland aktiv an den Protesten gegen die Notstandsgesetze und verliehen ihrem Kampf für Aufklärung und Emanzipation unter anderem über die Forderungen nach Abschaffung der Paragraphen 218 und 175 und für die politische und gesellschaftliche Gleichstellung neuen Aufwind. Dazu kamen wichtige Aktionen gegen das Berufsverbot, Forderungen nach Kürzung des Wehretats und die Kampagne Frauen in die Bundeswehr – wir sagen Nein!.
Ende der 60er Jahre kam in der Liga der Vorschlag auf, die durch Rüstung eingesparten Gelder für entwicklungspolitische Ziele wie die Bekämpfung von Hunger, Krankheiten und Analphabetismus zu verwenden – was viele Jahre später in der Kampagnen mündete: You get what you pay for oder Move the money from war to peace. Diese Forderungen trugen dazu bei, sich als Teil einer globalen Bewegung zu sehen.
Im veränderten Klima der späten 1960er Jahre – weg von der Hochrüstung, hin zur Entspannungspolitik – kommen 1970 unter der SPD gegen den massiven Widerstand der CDU/CSU die Ostverträge mit der Sowjetunion und Polen sowie 1971 das Viermächteabkommen zustande. Diese Entwicklung liegt ganz im Interesse der IFFF, da es ihr von Beginn an ein grundlegendes Ziel ist, die Beziehungen zur DDR und den anderen sozialistischen Staaten zu normalisieren.
1970 fand der erste Internationale Kongress im sogenannten Globalen Süden statt, in Neu Delhi. Ökonomische und soziale Gerechtigkeit als Bedingungen für Frieden und Freiheit standen im Mittelpunkt. Die Frauen forderten den Rückzug aller ausländischen Truppen aus Vietnam. Einer Delegation unter Leitung der Amerikanerin Kay Kamp gelang es, einen Friedensvertrag der Frauen aus den USA und Nord-und Südvietnam zu unterzeichnen.
Die Münchnerin Eleonore Romberg wurde in den internationalen WILPF-Vorstand gewählt und setzte sich zeitlebens für Brücken zwischen Ost-und West und eine Entspannungspolitik ein. Diese beinhaltete die Ostverträge, das 4-Mächte Abkommen und die vertragliche Festlegung auf den Verzicht von Atomwaffen auf deutschem Boden. Eleonore wurde später zweimal zur internationalen WILPF-Präsidentin gewählt (1972-1974 und 1986-1992).
Es ist der Verdienst von Eleonore Romberg und Edith Ballentyne, dass das Thema Frieden auf allen UN-Frauenkonferenzen behandelt wurde. 1978 fand nach intensiver Vorarbeit auch seitens der Frauenliga die erste UN-Sonderkonferenz zu Abrüstung statt. Ligamitglieder nahmen daran als Beobachter*innen teil. 1985 beteiligten sie sich an der dritten Weltfrauenkonferenz in Nairobi mit dem Slogan Kein Frieden ohne Emanzipation.
In Deutschland entwickelte die IFFF Aktivitäten gegen den NATO-Nachrüstungsbeschluss vom Dezember 1979. Ein großer Erfolg der IFFF ist die im internationalen Rahmen getragene STAR-Kampagne Stop the Arms Race (1982/83), um gegen die Stationierung neuer Waffen und Waffensysteme zu protestieren. Nach einer Demonstration von Zehntausenden von Frauen aus Westeuropa und den USA in Brüssel überreichten diese im NATO-Hauptquartier die gesammelten Unterschriften.
Die internationale Exekutivsitzung in München 1985 beschäftigte sich mit den Themen Wettrüsten – Weltwirtschaftskrise-Faschismus.

In den 1990er Jahren wuchs die internationale Frauenfriedensbewegung.
IFFF-Mitglieder in München organisierten eine Ausstellung gegen den zunehmenden Rassismus in Deutschland unter dem Titel „Dies ist auch unser Land – Ausländische Frauen in München“.
Der Krieg in Jugoslawien wurde heftig diskutiert und mündete 1992 in einem Solidaritätsprojekt. Weitere Frauenprojekte wurden unter anderem in Sri Lanka initiiert.
1995 fuhren 234 Frauen im Anschluss an den Internationalen Ligakongress in Helsinki mit dem „Peace Train“ nach Peking zur UN-Weltfrauenkonferenz. Sie hielten auf der Fahrt in St.Petersburg, Kiew, Bukarest, Sofia, Istanbul, Odessa und Almaty.
1998 nahmen Ligafrauen zur Erinnerung an 350 Jahre Westfälischer Frieden an den Festlichkeiten für eine europäische Friedensordnung teil. Zum Gedenken an die Haager Friedenskonferenz 1899 trafen sich WILPF-Mitglieder wieder in Den Haag zur Friedenskonferenz 1999. Dort unterzeichneten sie wie 100 Jahre zuvor einen Friedensappell.
Die Verabschiedung der UN-Resolution 1325 "Frauen, Frieden und Sicherheit" im Sicherheitsrat im Jahr 2000 war ein großer Erfolg der WILPF. An der Entstehung hatten Ligafrauen jahrzehntelang intensiv mitgearbeitet und setzen sich bis heute für die Umsetzung ein. In Deutschland setzte sich die IFFF für einen Nationalen Aktionsplan 1325 als Mitgliedsorganisation des Frauensicherheitsrats ein, der 2003 gegründet wurde. Der Rat existiert nicht mehr und die Arbeit wird inzwischen von dem Bündnis 1325 fortgesetzt.
Bereits seit Ende der 1980er Jahre erlangte das Thema Menschenhandel große Aufmerksamkeit. Die IFFF ist ein Gründungsmitglied des Koordinationskreises gegen Menschenhandel (KoK), der im Jahr 2000 gegründet wurde.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Antirassismusarbeit mit zahlreichen Workshops, wie zum Beispiel in Helenenau in Deutschland. Dort wurde auch die Teilnahme an der UN Weltkonferenz gegen Rassismus 2001 in Durban vorbereitet. Die Nicht-Teilnahme Deutschlands an der Konferenz empörte die IFFF.
Auf der internationalen Ebene fanden die Forderungen des Gipfels zur Nachhaltigen Entwicklung einen starken Nachhall: Auf dem internationalen Vorstandstreffen in Aucklang im Jahr 2002, wurde sich auf das Thema Wasser als Menschenrecht geeinigt.
Quellen und Literaturhinweise
- Margit Twellmann (Hrsg.), Erlebtes – Erschautes: Deutsche Frauen kämpfen für Freiheit, Recht und Frieden, von Lida Gustava Heymann in Zusammenarbeit mit Anita Augspurg (Heymann-Memoiren), Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan 1977
- Gisela Brinkler-Gabler (Hrsg.), Frauen gegen den Krieg, Fischer TB Verlag, Frankfurt 1980
- Gerit von Leitner, Wollen wir unsere Hände in Unschuld waschen? Gertrud Woker (1878-1968), Chemikerin – und Internationale Frauenliga 1915-1968, Weidler Buchverlag Berlin, 1998
- Helmut Donat, Karl Holl (Hrsg.), Hermes Handlexikon, Die Friedensbewegung, econ tb verlag Düsseldorf
- Archivunterlagen der IFFF – Deutsche Sektion
- Helga Meyer, Women’s Campaign against West German Rearmament 1949-1955, Doctorate Thesis at the University of Colorado, USA 1989
- Gertrude Bussey, Margaret Tims, Pioneers für Peace – Women’s International League für Peace and Freedm 1915-1965, Alden Press, Oxford 1980
- Sybille Krafft, Zwischen den Fronten. Münchner Frauen in Krieg und Frieden 1900-1950, Buchendorfer Verlag, München 1995
- Dorlies Pollmann/Edith Laudowicz, Weil ich das Leben liebe … Aus dem Leben engagierter Frauen, Pahl-Rugenstein, Köln 1981
- Hannelore Cyrus/Verena Steinecke, Ein Weib wie wir?! Auguste Kirchhoff (1867-1940), Verlag in der Sonnenstraße, Bremen 1989
- Elisabeth Brändle-Zeile, Seit 90 Jahren: Frauen für den Frieden, Windhueter Druck- und Verlagskollektiv, Schorndorf 1983
- Anna Dünnebier, Ursula Scheu, Die Rebellion ist ein Frau. Anita Augspurg und Lida G. Heymann – Das schillerndste Paar der Frauenbewegung, Sphinx Verlag, Kreuzlingen/München 2002
- Christiane Henke, Anita Augspurg, rororo TB 2000
Ein Teil der Altakten der IFFF ist in der Stiftung Archiv der deutschen Frauenforschung in Kassel zu finden.