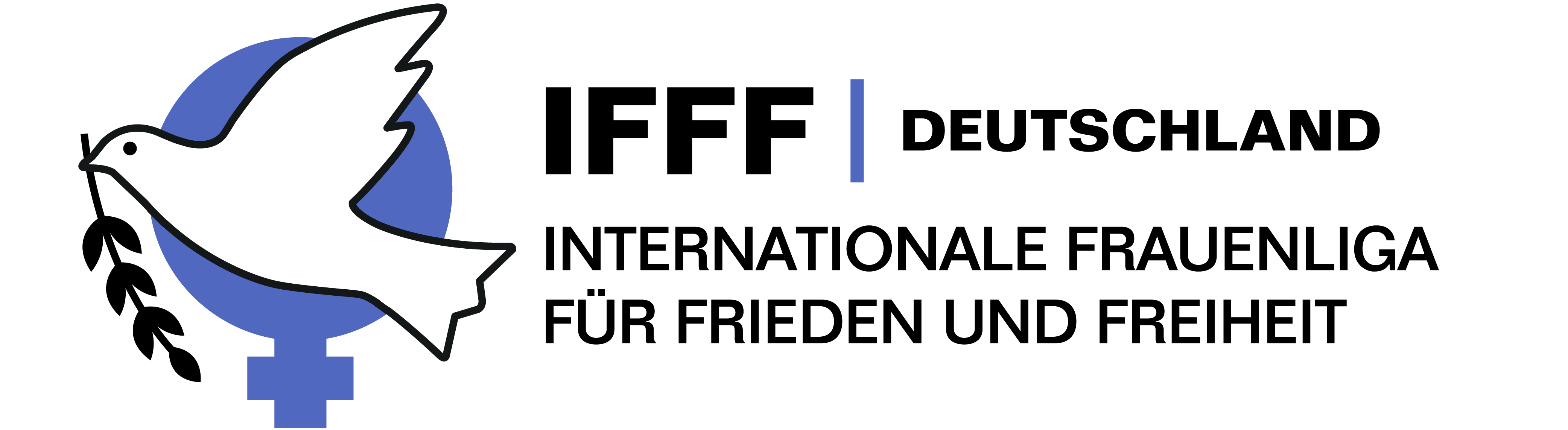WILPF-Mitglied Heidi Meinzolt nahm gemeinsam mit Mitgliedern weiterer europäischer Sektionen an der Helsinki+50 Konferenz teil und berichtet von ihren Erfahrungen.
Bericht von Heidi Meinzolt
Als 1975 in Helsinki die multilaterale Konferenz KSZE gegründet wurde, war es das Ziel, den Dialog zwischen Ost und West zu fördern. Dies kam einem Friedensabkommen für das Europa der Nachkriegszeit während der anhaltenden Ära des Kalten Krieges am nächsten. 1995 wurde aus der KSZE eine Organisation, die ihren Beitrag zur Bewältigung der historischen Umwälzungen und der neuen Herausforderungen in Europa bis Zentralasien, für Frieden und die Bewahrung der Menschenrechte leisten sollte. So erschloss die Schlussakte von Helsinki das notwendige Umfeld für Entspannung, Abrüstung und eine dynamische Friedens- und Menschenrechtsbewegung von globaler Bedeutung. War das 50-jährige Jubiläum ein Anlass zum Feiern und/oder eine Warnung, die moralische Legitimität der OSZE und ihrer Prinzipien nicht weiter auszuhöhlen, sondern Reformchancen auszuloten?

Multilateralismus und Frieden
Der Friedensgedanke war und ist eng verbunden mit einer multilateralen Ordnung. Das haben schon die Gründungsmütter der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit zum Ende des 1. Weltkriegs diskutiert. Sie haben aktiv an der Gründung des Völkerbundes mitgearbeitet, um durch eine internationale Schiedsgerichtsinstitution dem kriegstreiberischen Nationalismus den Boden zu entziehen. Nach dem Scheitern des Völkerbundes – ausgelöst durch die Nationalsozialisten – haben Ligafrauen nach dem 2. Weltkrieg an der Charta der Vereinten Nationen mitgeschrieben und arbeiten seither global vernetzt weiter an internationalen Konventionen, Abrüstungsverhandlungen und auch daran, grenzüberschreitend Frauen eine Stimme für Gerechtigkeit und Frieden zu verleihen. Der Weg von der KSZE zur OSZE als Brücke zwischen Ost und West, als Raum für Mediation und Dialog nach dem Konsensprinzip war immer ein wichtiger Bezugspunkt für die internationale Friedensarbeit der WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom) und für Konfliktprävention.
Die Veranstaltungen in Helsinki 2025 waren insofern ein willkommener Anlass auch für Friedensfrauen und Frauenorganisationen die sich stetig verringernden Spielräume für zivilgesellschaftliche Aktivitäten mit Freund*innen, Institutionen und Politiker*innen, die dafür offen sind, zu verteidigen. Auf der Grundlage ihrer feministisch-kritischen intersektionalen Analyse von Konflikt und Gewalt brachten sie konstruktive Zukunftsperspektiven ein, um dem Multilateralismus seine Bedeutung für die Menschen und ihn als Grundlage für Friedensarbeit zu erhalten.
Ein Schwerpunkt der Empfehlungen war, die drei Dimensionen der OSZE gedanklich und institutionell weiter miteinander zu verbinden, im Sinne einer zu schaffenden Friedensagenda:
a) die Sicherheitsdimension, die als Garant umfassender menschlicher Sicherheit klarer aufgestellt werden muss, auch im Hinblick auf Gewalt- und Konfliktprävention, einschließlich sexualisierter Gewalt;
b) die Menschenrechtsdimension, die die Anerkennung der Universalität und Unverletzlichkeit der Menschenrechte (einschließlich der Frauenrechte) für alle garantiert;
c) die Wirtschaftsdimension, die als Care-Ökonomie auszubauen ist, sowie hier mit eingeschlossen die Umweltdimension, die einen Schwerpunkt auf Klimagerechtigkeit in Verbindung mit Demilitarisierung setzen muss.
All dies war allerdings nur ein Randthema in Helsinki. Der Vorschlag, Empfehlungen weiterauszuarbeiten u.a. durch eine neu einzuberufende OSZE-Frauenkonferenz (wie 1990 in Berlin) blieb in der Luft hängen.
Zivilgesellschaftliche Vertreterinnen der CSP Arbeitsgruppe zur Genderthematik aus der Kaukasusregion, dem Balkan und Zentralasien mahnten zudem an, nicht die zahlreichen schwelenden Konflikte und Traumata aus dem Auge zu verlieren, bei denen die Notwendigkeit des gleichberechtigten Dialogs, der Beteiligung an der Umsetzung der Frauen-Frieden-Sicherheitsagenda, der Friedenserziehung und der Verteidigung offener Räume für Demokratieförderung vor Ort aktiv gefördert werden sollte, genauso wie auch Chancen für (nicht-militärische) Selbstverteidigung und Friedensbildung. Dies dürfte keinesfalls durch neue Gesetze weiter eingeschränkt werden.

Europäische Vertreterinnen verurteilten insbesondere das Programm der EU und europäischer Staaten zur massiven Aufrüstung – nicht nur wegen der hierdurch zustande kommenden astronomischen Profite der Rüstungsindustrie. Es führe zur Militarisierung aller Lebensbereiche, insbesondere von Bildungseinrichtungen. Die existenzielle Gefährdung allen Lebens durch den angedrohten Einsatz von Atomwaffen und die Ausweitung militärischer Allianzen, insbesondere der NATO (siehe GWUAN Erklärungen) nahmen einen besonderen Raum ein. Man war sich einig, dass die einseitige Konzentration auf militärische Sicherheit nur neue und alte Hass -und Feindbilder zementiere und das notwendige Geld für Vermittlungsmissionen, Verhandlungen, soziale Programme gegen Ausgrenzung und Ausbeutung und den Zusammenhalt der Gesellschaften stehle. Zivilgesellschaftlicher Beifall traf weitgehend auf institutionelles (und mediales) Unverständnis oder einfach Schweigen.
Hat die Idee der gemeinsamen Sicherheit noch eine Zukunft?
In der feministischen Diskussion steht das Themas Sicherheit immer in einer grundsätzlichen Verbindung mit der Überwindung von Gewalt. Sorge um die individuelle und kollektive Sicherheit ist ein gemeinsames und Grenzen überschreitendes Projekt, das Gesundheit und soziale Sicherheit, sexuelle und reproduktive Rechte, Bildung, Zugang zu Ressourcen zu und politisch relevanten Entscheidungen, einschließt. Hierfür gibt es keine nationalen Grenzen. Die Perspektive der gemeinsamen Sicherheit ist also für Frauen etwas Selbstverständliches.
In Helsinki wird diese allenthalben als große Errungenschaft gefeiert – die politische Realität spricht jedoch eine andere Sprache. Die Helsinki Prinzipien haben keine 50 Jahre gehalten und sie haben leider nie die (politisch-mediale) Bedeutung erhalten, die sie verdient hätten. Die Festveranstaltung in Helsinki hat es zwar irgendwie geschafft, die Mottenkiste der Lippenbekenntnisse etwas zu entstauben und an ein gemeinschaftliches menschliches, komplexes Sicherheitsverständnis für alle Mitgliedsstaaten (– aber auch für deren Menschen?) zu erinnern.
Die vielen sichtbaren (und auch unsichtbaren) Mauern und Zäune, die Remilitarisierung, aber vor allem die Außerachtlassung verschiedener internationaler militärischer Dynamiken, die die ‚Zeitenwende‘ prägen, haben den Schwung für eine Erneuerung der Organisation und die Priorität der Idee der Gemeinsamkeit klar ausgebremst.
Bezeichnend für das Nebengleis, auf das man in der politischen Praxis die Idee der Gemeinsamen Sicherheit geschoben hat, war auch die sichtbar eher bescheidene Teilnahme politischer Entscheidungsträger*innen am Event. Die diplomatische Qualität der Forderung nach einer gemeinsamen Sicherheit und dessen Umsetzung passen aktuell nicht zur „Realpolitik“. So verschwanden die Chancen der OSZE als Brückenbauer*in, Verhandler*in, Mediator*in hinter der geostrategischen Gemengelage von Macht und Einfluss.
So überließ dann auch die Stadt Helsinki den Begrüßungsempfang bis auf eine kurze launige Begrüßung seitens der Außenministerin mit einer Bemerkung über das herrliche Wetter („genau wie vor 50 Jahren“) fast ausschließlich der Zivilgesellschaft und einem üppigen Buffet: Dies war zwar Anlass für spannende Gespräche unter uns Aktivist*innen und Think Tanks, hatte aber darüber hinaus keinerlei Außenwirkung. Nicht einmal in Helsinki selbst wurde das „Ereignis“ von Bürger*innen und Tourist*innen wahrgenommen.
Eröffnungszeremonie und Festveranstaltung zu Helsinki+50 in Helsinki 2025
War es dann auch symbolisch gemeint oder lediglich ein leicht misszuverstehender kultureller Beitrag zur Eröffnung der Feierlichkeiten in der Finlandia-Halle in Helsinki, als ein reiner Männerchor einmarschierte? Dieser sang nicht wirklich, sondern schrie mit fast brutaler Emotion die Helsinki-Prinzipien heraus – das war eher abschreckend denn überzeugend!

Daraufhin wurde die rühmliche Vergangenheit der Verträge und der politischen Meilensteine auf dem Weg von der KSZE zur OSZE gepriesen, um sich in der Folge vor allem damit zu beschäftigen, dass all diese wertvollen Prinzipien aktuell ausschließlich von Russland verletzt werden würden. Aber sind wir nicht aktuell Zeug*innen einer Welt, in der neben Russland auch noch viele weitere Regierende diese Prinzipien mit Füßen treten?
Die dominierende männliche Präsenz auf der Bühne – übrigens auch in den Foren – wurde von engagierten Feminist*innen eher als ein schlechter Scherz empfunden. Als Beleg dafür, aber auch als Ansporn, dass es für Feminist*innen noch viel zu tun gibt und sie in der Realpolitik noch weit entfernt von ihrer Vision einer gleichberechtigteren, gerechteren und friedlicheren Welt oder Gesellschaft sind!
In den Grundsatzreden und Podiumsdiskussionen zu den Themen RESPEKT, REAGIEREN und VORBEREITEN, gab es natürlich zahlreiche politische Bekenntnisse dazu, wie Helsinki eine neue Qualität in die internationalen Beziehungen gebracht und den Multilateralismus gestärkt habe. So konnte selbst ein kritisches Publikum einen Moment den Eindruck gewinnen, dass unter den – wenigen anwesenden führenden Politiker*innen nach wie vor ein starker Glaube an diese Prinzipien herrsche, auch mit Chancen für die Zukunft.
Der offiziell zum Ausdruck gebrachte Wille, die Prinzipien aufrechtzuerhalten und sie neuen Herausforderungen anzupassen, war lediglich ein sich selbst feiern. Schon im Laufe der Veranstaltung und vor allem im Nachhinein, schälte sich die Erkenntnis heraus, dass diese Werte der Vergangenheit zugeordnet, und von der dramatischen politischen Realität in der gesamten OSZE-Region mit den vielen Konflikten und Kriegen, dem zunehmenden Nationalismus, dem autoritärem Führungspersonal sowie dem schrumpfenden zivilgesellschaftlichen Raum, insbesondere dabei dem geschlechtsspezifischen, überlagert wurde.
Die allseits auch spürbare Hilflosigkeit gebar nichts Wegweisendes für den Weltfrieden, sondern beschwor quasi unisono Abschreckung (einschließlich der nuklearen Drohung) und segnete undemokratische Entwicklungen, (neue) Nationalismen und Autoritarismus durch ihr Stillschweigen ab. Aufrüstung wurde als das unverzichtbare Gebot der Stunde beschworen.
Auch wenn manche betonten, dass die Aufteilung und Einordnung in „westlich und östlich von Wien“ wegen der kompromittierten „westlichen Werte“ nicht mehr sinnvoll sei, war man nicht bereit, neue konstruktive Wege zur Vermittlung und Deeskalation für die Vielzahl schwelender Konflikte aufzuzeigen – von der fehlenden Verknüpfung mit Kriegen in der Welt mal ganz abgesehen. Es war der dringende Appell einer einzelnen jungen Frau – übrigens vorgetragen auf dem einzigen Frauenpodium – mit dem sie es wagte, Gaza und die Verantwortung Israels für einen Genozid, bzw. der internationalen Gemeinschaft für das Zulassen von diesem, zu erwähnen! Sie erhielt großen Applaus vom Publikum, weniger von den Vertretern der Institutionen.
Fehlender Enthusiasmus und Reformwille schlug sich auch in fehlender Berichterstattung von Seiten der Medien nieder. Es gab leider nichts Spektakuläres zu berichten, weder von einem Durch- noch von einem Aufbruch – keine nach vorne gerichteten Visionen konnten aufgezeigt werden. Der Elefant im Raum blieb Russlands Angriffskrieg, umrahmt durch restriktive Migrationspolitik, Abschiebungen und Abgrenzung.
Fazit: Helsinki bot eine Show, die „nichts wirklich Neues” brachte. Aber es war, in aller Bescheidenheit, trotzdem eine Möglichkeit, öffentlich über gemeinsame Sicherheit und die Wahrung der Grundsätze des Völkerrechts zumindest zu sprechen, eine immer seltener werdende Gelegenheit. Leider haben es die (internationalen und Mainstream-) Medien versäumt, gerade diesen Aspekt öffentlich herauszustellen – also wieder einmal eine verpasste Chance!
Die Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, die an der Vorbereitung von Helsinki+50 mit zahlreichen Analysen und Empfehlungen mitgearbeitet hatten, verließen die Veranstaltung mit gemischten Gefühlen. Reicht das aus, um einen gewissen Optimismus zu bewahren, „aus der Vergangenheit zu lernen und Hoffnungen für die nächsten 50 Jahre zu hegen“, wie es in den offiziellen Dokumenten heißt? Es liegt an uns Frauen, weiter über die Chancen und Herausforderungen des Multilateralismus zu sprechen, um die fatale Verbindung von Nationalismus, Militarismus und Patriarchat zu stoppen. Andernfalls verliert die gesamte Menschheit.
Was wäre nötig, um der Idee der gemeinsamen Sicherheit eine Chance für die Zukunft zu geben?
Zahlreiche zivilgesellschaftliche Vertreter*innen aus dem gesamten OSZE-Raum haben ihre Ideen, die sie das Jahr über in off- und online Seminaren erarbeitet hatten, nach Helsinki gebracht: Vertrauensbildung, gemeinsamer Ideenaustausch und Projekte unter Führung der Zivilgesellschaft, aktive nachbarschaftliche Dialoge, intersektionale Frühwarnsysteme und friedensförderndes (erzieherisches) Handeln zur Bearbeitung von Konflikten in allen ihren Phasen. Der Austausch untereinander am Rande der offiziellen Feierlichkeiten und in Parallelveranstaltungen war reich und wird, ja muss, fortgesetzt werden – das war der berühmte zivilgesellschaftliche und grenzüberschreitende Konsens.

Es gab eine Parallelveranstaltung der CSP und einen Beratungstag mit handverlesener Vertretung der Zivilgesellschaft zur Bestätigung der Helsinki-Prinzipien und für konkrete Reformschritte bezogen auf alle 3 Dimensionen der OSZE:
Im Prinzip war der Beratungstag ein interessantes Format, um in kleineren Gruppen zivilgesellschaftliche Empfehlungen zusammenzutragen, mit institutionellen und wissenschaftlichen Vertreter*innen zu diskutieren und diese am Ende in die Botschafterversammlung der OSZE hineinzutragen. Viele konstruktive Ideen wurden aber auf einige wenige Minimalforderungen zusammengeschmolzen, zu „machbaren“, verstehbaren (für wen?) Reformideen.
Genderaspekte und feministische Ansätze, sowohl in der Definition der gleichberechtigten Zusammensetzung von Zivilgesellschaft und der besonderen Bedeutung von feministischen intersektionalen Konfliktanalysen und praktischen Erfahrungen der Friedensbildung, insbesondere der Frauen vor Ort, blieben im Schlussbericht außen vor.
Es besteht noch eine kleine Chance, dass einige der Empfehlungen ihren Niederschlag finden in dem von Anu Juvonen, der Zivilgesellschaftsbeauftragten der finnischen Regierung, angekündigten zivilgesellschaftlichen Abschlussbericht.
Das völlige Ausbleiben von Reaktionen und das Fehlen jeglicher Nachfragen von Seiten der Botschafter*innenriege im Saal am Schluss der Präsentation dieser Empfehlungen stimmte – vorsichtig gesagt – nicht gerade optimistisch, was die Reformbereitschaft der Institution aus sich selbst heraus anbelangt.
Fazit: Die Zivilgesellschaft muss weiter dranbleiben! Uns bleibt nur, weiterzumachen, die notwendige Resilienz zu entwickeln, Solidarität und Radikalität zu verbinden, miteinander im konstruktiven Austausch zu bleiben.
Ein paar wenige Aspekte aus unseren Forderungen, die zur Sprache kamen:
- Wir brauchen mehr grenzüberschreitende und geförderte zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur Stärkung der „gemeinsamen Sicherheit“, zur Bekämpfung von Nationalismen und zur Stärkung sowohl lokaler als auch grenzüberschreitender Vertrauensbildung und Resilienz.
- Friedliche Entwicklung und Konfliktprävention basieren auf der systematischen Verbindung von: umfassender menschlicher Sicherheit, Care-Ökonomie und Klimagerechtigkeit. Diese Verbindung braucht verstärkt institutionelle Unterstützung für lokal und international vernetzte Aktivitäten.
- Die verbale Trennung von östlich und westlich von Wien ist nicht mehr sinnvoll. Es gibt nicht die „westlichen“ Werte – Werte sind universell. Demokratie braucht überall Unterstützung zur Lösung der Probleme der Menschen und zur Verbesserung ihrer Chancen für ein bescheidenes Leben in Sicherheit sowie zur Verhinderung gesellschaftlicher Spaltung als permanentem Konfliktfaktor.
- Jede Chance für Abrüstungsinitiativen, insbesondere auch bezogen auf illegale Landminen, automatische Waffen und nukleare Abschreckung müssen mit Unterstützung der zivilgesellschaftlichen Expert*innen ausgelotet werden.
- Frauen vor Ort sind wertvolle Garant*innen für eine effektive Frühwarnung in allen Sektoren des gesellschaftlichen Lebens. Strukturen, die den Zugang zu Institutionen erleichtern helfen und Transparenz hinsichtlich entsprechender Angebote sind unverzichtbar.
- Die öffentliche Sichtbarkeit der OSZE-Mechanismen und Strukturen muss erhöht werden: durch die regelmäßige systematische Einbindung aktiver Zivilgesellschaft in allen Dimensionen, auch im Rahmen der Troika, der parlamentarischen Versammlungen und in Verbindung mit anderen Organismen, wie z.B. dem Europarat.
- Eine spezifische OSZE-Frauenkonferenz, wie schon 1990, wäre wünschenswert, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen.